Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
19. August 2025Nahbarkeit
19. August 2025Schuld und Schulden
15. August 2025Unser Freund, das Aton
15. August 2025Ein Sparkommisar?
12. August 2025Wohltemperiert
09. August 2025Demokratie-Industrie
09. August 2025Schlank werden
05. August 2025Booster-Boomer
05. August 2025Ein Lob des Stammtischs
02. August 2025Lokomotive des Fortschritts
17. März 2025
Der Kündigungsagent
Warum man nicht immer authentisch sein braucht
In Japan gibt es spezielle Agenturen, die Angestellten die Kündigung bei ihrem Arbeitgeber abnehmen. Darüber habe ich kürzlich in der Financial Times gelesen. Japaner gehen nicht zu ihrem Boss und sagen: »Hiermit kündige ich« oder verfassen ein Schreiben an die Personalabteilung, in dem sie mitteilen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt das Unternehmen verlassen zu wollen. Sondern sie mandatieren einen Dienstleister, der für sie den gesamten Prozess abwickelt: Ausschließlich die vertretende Agentur kommuniziert mit dem Arbeitgeber, regelt die arbeitsrechtlichen Dinge, den Zeitpunkt des Ausscheidens und klärt, wann das Diensthandy und der Dienstwagen zurückgegeben wird. Das machen die natürlich nicht umsonst. Der Service kostet im günstigen Fall umgerechnet 150 Euro pro Kündigung.
Nun könnte man sagen: Andere Länder, andere Sitten. Oder man könnte mit der Theorie der Arbeitsteilung argumentieren: Wenn es Headhunter gibt, die einem einen Job vermitteln, darf es auch Spezialisten geben, die einem dabei helfen, den Job wieder loszuwerden. Doch das Verhalten bleibt – aus dem fernen Westen betrachtet – kurios und irrational. Warum geben Leute in Japan Geld für eine Dienstleistung aus, eine Formalie, die sie ohne zusätzliche Kosten selbst übernehmen könnten? In Europa oder USA kommt, soviel ich weiß, niemand auf die Idee, sich einen Kündigungsagenten zu nehmen.
Tatsächlich ist eine Kündigung eben nicht »kostenlos«. Jedenfalls ist das in Japan so, wo andere kulturelle Normen gelten. Erwartet wird – oder wurde jedenfalls lange Zeit -, dass man möglichst ein Leben lang treu beim selben Arbeitgeber bleibt, diesem dafür dankbar ist und klaglos bis in die Nacht hinein schuftet. Wer kündigt, fühlt sich schuldig. Und fürchtet, er könnte den Konflikt der Trennung allein nicht durchhalten. Sein Boss könnte ihn womöglich überreden, zumindest noch bis zum Ende des laufenden Projekts zu bleiben, um die Kollegen nicht im Stich zu lassen. Oder, schlimmer noch, der Vorgesetzte könnte die Gründe für die Kündigung erfragen – und dann müsste der Untergebene ihm ehrlich ins Gesicht sagen, dass er sich nicht gut behandelt fühlt. So eine Blöße will niemand sich geben, die dem Höhergestellten einen Gesichtsverlust zumutet.
Die Kosten der Kommunikation
»Zu kommunizieren hat für Japaner hohe Kosten«, erklärt Daisuke Kanama, ein Ökonomieprofessor, der ein Buch über die »leise kündigende Jugend« Japans geschrieben hat. Im Vergleich mit den Kommunikationskosten der Kündigung sind 150 Euro Delegationsgebühren zur Vermeidung dieser Gewissensqual günstig. Man zahlt für die Vermeidung von Kommunikation und Konfrontation. Und entledigt sich des Risikos, mit moralischen Appellen oder persönlich bedrängender Kritik zur Revision seiner Absicht genötigt zu werden. Im Lichte dieser Gewissensüberlegungen wird die Entstehung eines Marktes von Kündigungsagenturen plötzlich eine rationale Angelegenheit. Auch wenn diese Agenturen sich derzeit noch in einer rechtlichen Grauzone bewegen, wie die Financial Times schreibt.
Unter der Perspektive rationaler Kosten-Nutzen-Erwägungen scheint mir das Verhalten der Japaner plötzlich gar nicht mehr so fernöstlich kurios zu sein, wie es auf den ersten Blick daherkommt. Im Westen profitieren Unternehmensberatungen wie McKinsey & Co. seit vielen Jahrzehnten vom menschlich verständlichen Wunsch der Vermeidung direkter Kommunikations- und Konfrontationskosten. Ist es nicht einfacher, der Belegschaft und den Gewerkschaften zu sagen, der Berater habe dringend empfohlen, die Zahl der Mitarbeiter um zehn Prozent zu reduzieren, um international konkurrenzfähig zu bleiben? Der Vorstand ist fein raus, nach dem Motto: Da kann man nichts machen.
Im Preis der Dienstleister ist quasi ein Aufschlag für die Rolle des »Bad Guy« oder wahlweise des »Sündenbocks« enthalten. Unpopuläre Entscheidungen werden externalisiert. In der betriebswirtschaftlichen Literatur ist der Mechanismus längst untersucht. »Moral Licencing« heißt der Prozess, durch den sich Vorstände reinwaschen können, wenn sie externe Berater hinzuziehen. Von den Externen gibt es nicht nur nüchterne Analysen, sondern auch Narrative, die die Rationalisierung als »alternativlos« darstellen.
Das Problem ist nur, dass »Moral Licencing« kein Zaubermittel ist. Die Mitarbeiter merken die Absicht und reagieren verstimmt. Da geben die Chefs viel Geld aus für das Ziel, Geld zu sparen. Das sieht zumindest vordergründig paradox aus, weil es nicht leicht fällt nachzuweisen, dass sich die für Beratung ausgegebene Summe in künftigen Bilanzen rechnen wird.
Institutionen entlasten
Externalisierer leben mit dem moralischen Makel der Verlogenheit, zumindest der absichtsvollen Unaufrichtigkeit. Dahinter verbirgt sich ein philosophischer Grundsatzstreit. Das Pathos der Aufklärung verlangt Ehrlichkeit und Direktheit der Kommunikation. »Sei authentisch!«, so geht der moralische Imperativ. Gegen diese Authentizitätszumutung gibt es eine lange Tradition in der sogenannten philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts, die mit den Namen Max Scheler, Helmuth Plessner und Arnold Gehlen verbunden ist. Diese Denker vertreten die Auffassung, der Mensch sei ein »Mängelwesen«, weil ihm die angeborenen Instinkte abgehen, mit denen sich die Tiere durch das Leben bewegen. Doch gerade diese Schwäche haben die Menschen zu einer Stärke umgewidmet. Sie können den Mangel kompensieren, indem sie sich Institutionen zimmern, die das scheinbar instinktreduzierte Unvermögen ausgleichen. Kultur, Technik – und vor allem die Institutionen des Marktes wären so gesehen hilfreiche Krücken, eine Errungenschaft menschlicher Fortschrittsgeschichte.
Scheler, Plessner, Gehlen gelten als »konservativ«. So habe ich es in den siebziger Jahren an der Universität gelernt. »Progressiv« dagegen waren die Helden der kritischen Theorie Adorno, Horkheimer und deren Nachfolger. Doch was heißt schon konservativ und progressiv? Die Klischees verschwimmen rasch, so kann man es in einem gerade bei Klett-Cotta erschienenen Buch von Thomas Wagner über »Die großen Jahre der Soziologie« nach 1945 nachlesen, in dem Gehlen und Adorno als Protagonisten auftreten. Der Vorwurf der Unaufrichtigkeit allemal billig.
Zurück nach Japan. Es scheint mir nicht nur mehr als verständlich zu sein, dass die Japaner sich die Gewissensbisse verursachenden Qualen einer Kündigung ersparen wollen und dafür Geld zu zahlen bereit sind. Es ist zudem eine wunderbare Leistung des Marktes, dass für dieses Bedürfnis auch ein Angebot entsteht und Dienstleister diese Arbeit übernehmen. Und am Ende kann man dabei zugucken, wie gesellschaftliche Evolution funktioniert: Die starre Kultur lebenslanger Beschäftigung in einem Unternehmen mit unzumutbar aufopfernden Loyalitätszumutungen wird sich lockern. Ein Gewinn an Freiheit für die Menschen.
Rainer Hank
17. März 2025
Hart arbeiten, früh aufstehen
Warum eigentlich haben Morgenstunden Gold im Mund?
In einem der vielen Quadrelle vor der Wahl traf die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht auf Dorothee Bär, stellevertretende Vorsitzende der CSU. Es ging um das Bürgergeld. Einig waren sich die beiden Politikerinnen, dass sich für Menschen, »die hart arbeiten und früh aufstehen«, ihr Einsatz finanziell lohnen müsse. Und dass es die hart arbeitenden und früh aufstehenden Menschen empöre, wenn andere sich im Bürgergeld einrichten – ohne zu arbeiten.
Das Argument ist geläufig und einleuchtend. Werden Anreize zu arbeiten durch üppige Angebote staatlicher Unterstützung (Bürgergeld, garantiertes Grundeinkommen) unterlaufen, bekommen wir ein Gerechtigkeitsproblem. Und ein ökonomisches obendrein, weil die Deutschen derzeit zu wenige Wochenstunden und Lebensjahre arbeiten – ein Grund für die anhaltende Wachstumsschwäche des Standorts.
Aber müssen wir dafür unbedingt früh aufstehen? Ist etwa die Arbeit eines Spätaufstehers weniger wert als der Einsatz des Frühaufstehers? Sind Arbeitsethos und Produktivität ans Frühaufstehen gebunden? Arbeiten die Südeuropäer, die bekanntlich später anfangen, weniger hart als wir Mitteleuropäer? Ihre Wirtschaft wächst derzeit schneller als die unsrige. Haben die Menschen in der DDR, die häufig schon um 6 oder 7 Uhr auf der Arbeit waren, mehr Wohlstand geschaffen als ihre bundesrepublikanischen Nachbarn, die später anfingen? Dann müssten wir etwas verpasst haben.
Klar, der Frühaufsteher ist eine feste Redewendung. Morgenstund› hat Gold im Mund und der frühe Vogel frisst den Wurm. Aber warum eigentlich? Der Langschläfer gilt als faul, wenig produktiv, wenig leistungsmotiviert. Wer rastet, der rostet.
Gräbt man nach den historischen Wurzeln stößt man auf Preußens Tugenden der Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit. Soldaten, Beamte und Arbeiter wurden getrimmt, früh aufzustehen und den Tag strukturiert zu beginnen. Die Industriearbeiter des 19. Jahrhunderts mussten lernen, sich dem Takt der Maschine anzupassen. Das Fließband im Dreischichtbetrieb schläft nie. Nur die Aristokratie kam spät zum Frühstück; wie das ausging wissen wir seit der Französischen Revolution.
Zeit ist Geld
Der prominenteste Frühaufsteher-Versteher ist Max Weber. In seiner »Protestantischen Ethik« kommt er auf den Rat eines alten Geschäftsmannes an einen jungen Kollegen zu sprechen. Der beginnt mit dem Urwort des Kapitalismus »Zeit ist Geld«. Der Langschläfer bringt es zu nichts, soll das heißen. Vernimmt der Gläubiger morgens um Fünf nicht den Hammerschlag des Handwerkers, wird er nervös: Denn er muss muss befürchten, der Schuldner werde seinen Kredit nicht bedienen können.
Fleiß, Disziplin und Askese, all das, was uns nach Max Weber reich werden ließ, hat offenbar einen Zeitindex. Richard Baxter (1615 bis 1691), ein protestantischer Pfarrer und puritanischer Erbauungsschriftsteller aus England, hatte eine theologische Begründung parat, warum Zeitverschwendung die erste und schwerste aller Sünden sei. Die Zeitspanne des Lebens sei unendlich kurz und kostbar, um die eigene Berufung zu entfalten. Zeitverlust durch Geselligkeit, faules Gerede, Luxus, selbst länger als für die Gesundheit nötig zu schlafen (6 bis 8 Stunden immerhin waren erlaubt) seien »sittlich absolut verwerflich«, so der Pfarrer.
Das mündet bei Baxter in das Bonmot, man müsse früh aufstehen und früh zu Bett gehen: »Early to bed and early to rise makes a man healthy and wise«. In einer Zeit, der das christliche Sündenbewusstsein verloren gegangen ist, stellt die Verführbarkeit von üppiger staatlicher Alimentierung eine große Gefahr dar. Das ist es, was Bär und Wagenknecht eint. Eingeräumt wird unausgesprochen, dass die Motivation, früh am Morgen schon Leistung erbringen zu müssen, nicht selbstverständlich ist und deshalb nicht durch negative Anreize gefährdet werden darf. Anfällig dafür ist nicht nur der Morgenmuffel.
Ich vermute – ohne besondere Empirie vorweisen zu können -, dass die Anzahl der Menschen, die Mühe haben, morgens aus dem Bett zu kommen, größer ist als die Zahl jener, die morgens munter auf der Matte stehen. Es wundert nicht, dass gegen den asketischen Imperativ der frühen und harten Arbeit, früh schon sich Widerstand regte. Da sind zunächst jene Leistungstotalverweigerer, die gar nicht aufstehen. Ihr Held ist der Grieche Diogenes in seiner Tonne, dem der großen Alexander – mit Sicherheit ein Frühaufsteher – einen Gefallen tun möchte: »Geh mir aus der Sonne«, so die subversive Antwort des Diogenes. Dies begründete eine Ethik der Faulheit (vornehm Muße genannt), die sich von theologischen Verdammungsurteilen, eine Todsünde zu begehen, nicht einschüchtern ließ. In diese Tradition gehören Figuren wie der lebensuntüchtige Oblomow, Gontscharows Held, der lieber seine Tagträume pflegte als früh zur Arbeit aufzubrechen.
Tags schlafen, nachts arbeiten
Die weniger radikale Spezies der Morgenverächter will ich Partialverweigerer nennen. Sie arbeiten zwar, bestreiten aber, dass Morgenstund Gold im Mund habe. So eine Haltung muss man sich leisten können, weswegen sie – abermals ohne Empirie behauptet – unter Intellektuellen und Universitätsprofessoren verbreiteter ist als bei den Facharbeitern am Band von Mercedes. Zu Meisterschaft brachte es der Philosoph Hans Blumenberg, der prinzipiell nur des Nachts schrieb mit der plausiblen Begründung, da werde er nicht von lästigen Telefonanrufen gestört. Der Historiker Heinrich August Winkler, so erzählt man sich, macht nie Termine vor 12 Uhr mittags, weil er die Nacht durcharbeitet. Hat es seinem Output geschadet? Eher nicht, wenn ich auf die dicken Bände über »Deutschlands Gang in den Westen« schaue, die in meinem Bücherregal stehen.
So wurde dann auch der puritanische Spruch, man solle früh zu Bett zu gehen und früh aufstehen, früh als mörderisch verballhornt: Early to rise and early to bed makes a man healthy, wealthy and dead. Als ich jüngst an einem Werktag mitten in einer Sitzungswoche in Berlins Politpromicafé Einstein um acht Uhr morgens zum Frühstück kam, blieb ich mehr als eine halbe Stunde lang der einzige Gast.
Soll man daraus schließen, Politiker seien faul? Keinesfalls. Sie beherzigen lediglich eine andere Verballhornung des puritanischen Imperativs, die sich zwar nicht reimt, aber ebenfalls wahr ist: »Early to bed and early to rise and you never meet any prominent people«. Diese Abwandlung stammt von dem amerikanischen Schriftsteller Carl Sandburg und macht aufmerksam, dass es für erfolgreiche Networker der Politik keinen Feierabend geben kann. Die Politiker müssen dann eben morgens ihren Schlaf nachholen, was ein Fehler sein mag: Denn die Lobbyisten Berlins schlafen nicht und spinnen auch schon morgens ihre Intrigen.
Rainer Hank
04. März 2025
Kriegswirtschaft
Wer soll das alles bezahlen?
So langsam glauben wir es. Europa und Deutschland müssen für ihre Verteidigung selbst sorgen. Und dies in Zeiten, in denen die Bedrohung aus Putins Russland so real und gefährlich ist wie nie seit dem Kalten Krieg. Bedenklich oft sagen kluge Leute inzwischen, wir stünden am Vorabend eines dritten Weltkriegs. Amerika habe seine Schuldigkeit getan, sagt Präsident Trump sinngemäß. Jeder wird sich künftig selbst der Nächste sein müssen.
Wir haben in Deutschland 35 Jahre lang, also seit dem Fall des Kommunistischen Reiches, »defunding the Bundeswehr« betrieben, sagt der an der London School of Economics lehrende Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschl: Wir haben nicht nur militärisch, sondern im Gleichschritt damit auch finanziell abgerüstet. Im Jahr 1994 zählte die Bundeswehr 361.000 Soldaten, heute sind es 181.000.
Nach der »Zeitenwende« und dem hundert Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr hat sich nichts Nennenswertes geändert. Was der Bundeswehr zugesprochen wurde, hat man an anderer Stelle wieder gekürzt. Vom Rest wurde viel Geld für die Ukraine verwendet. Am Ende ist für unsere Verteidigungsfähigkeit – Boris Pistorius spricht von »Kriegstüchtigkeit« – nicht sehr viel geblieben. »Unsere Bundeswehr steht heute nicht viel besser da als die Reichswehr in der Weimarer Republik unter dem Versailler Vertrag«, sagt der Historiker Ritschl: Mit dem einzigen Unterschied – dieses Mal war alles freiwillig.
Jetzt muss plötzlich alles schnell gehen. Und sehr üppig werden: Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), drei Prozent, fünf Prozent sind geboten. Wer bietet mehr? Ein Prozent beläuft sich bezogen auf das derzeitige BIP auf gut 40 Milliarden Euro. Wer soll das bezahlen?
Not kennt kein Gebot. Wirklich?
Woher kommt eigentlich die Kopplung der Verteidigungsausgaben an die Wirtschaftsleistung? Selbstverständlich ist das nicht. Gewiss, man könnte argumentieren, wer viele Menschen, viele Wohnhäuser und viele Fabriken schützen muss, müsse mehr Geld einsetzen als ein kleines Land. Als Maß käme alternativ auch die Höhe des Risikos und der Bedrohung durch einen Aggressor infrage. Dann müsste Deutschland – näher an Putin dran – prozentual mehr Geld einsetzen als, sagen wir, Irland. Aber das würde den Solidaritätsgedanken der Nato und der Europäischen Union vollends zermalmen.
Not kennt kein Gebot, so hören wir es allenthalben. Das heißt: Wer bislang noch an der Schuldenbremse festhalten wollte, müsse spätestens jetzt einsichtig werden und kapitulieren. Eine disziplinierte Haushaltspolitik nützt nachkommenden Generationen nichts, wenn die Menschen tot sind – so der moralische Erpressungshammer. Vermutlich geht es weniger um Moral und die nachfolgenden Generationen als den (verständlichen) Wunsch, alles möge so bleiben wie wir es gewohnt sind. Da bietet sich der Rückgriff auf die Staatsverschuldung durch Ausgabe von Kriegsanleihen an. Dann merkt es keiner. Vermeintlich.
Es ginge auch anders. Das lehrt ein Blick in die deutsche Nachkriegsgeschichte, den die Ökonomen Lars Feld, Veronika Grimm und Volker Wieland in einer für die »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« erstellten Studie präsentieren. Nach der Wiederbewaffnung seit Mitte der Fünfziger Jahren und während den heißen Jahren des Kalten Krieges (Kubakrise), als der Westen einen Dritten Weltkrieg fürchtete, beliefen sich die deutschen Verteidigungsausgaben auf jährlich vier bis fünf Prozent des BIP. So blieb das mehr oder weniger bis 1990. Erst danach gingen die Ausgaben deutlich zurück auf nur noch gut ein Prozent. Den Deutschen war diese »Friedensdividende« gerade recht; sie mussten die Wiedervereinigung finanziell stemmen.
Hätte man die Verteidigung damals über mehr Schulden finanziert, müsste Anfang der sechziger Jahre die Staatsverschuldung nach oben geschnellt sein. Aber so ist es nicht. 1960 betrug die Schuldenquote Deutschlands nach Angaben des Internationalen Währungsfonds 18,4 Prozent; 1945 waren es mit 17,8 Prozent kaum weniger. Heute beträgt die Verschuldung gut 60 Prozent, was geschichtsvergessene Politiker gerne »wenig« nennen. Damals war man der Meinung, Verteidigung sei eine Daueraufgabe, die über die Einnahmen aus Steuern finanziert werden müsse. Wenn wir heute mit guten Gründen der Meinung sind, Kriegstüchtigkeit sei – leider – eine Daueraufgabe, so müsste das Geld konsequenterweise auch aus dem Steueraufkommen genommen werden. Sollten höhere Steuern aus Gründen der Gerechtigkeit und der Konjunktur als unzumutbar erachtet werden, bliebe nur, Staatsausgaben an anderer Stelle zu kürzen.
Boomer können verzichten
Wie kommt es, dass Deutschland sich in den sechziger Jahren vergleichsweise hohe Verteidigungsausgaben leisten konnte? Grob gesagt, liegt es an einer anderen Priorisierung. Verteidigungsfähigkeit war dem Staat damals sehr wichtig, »das Soziale« spielte noch nicht die dominante Rolle, die es heute spielt. Am ehesten ähnelt der Staat Israel und sein heutiger Haushalt der Welt Deutschlands im Kalten Krieg. Dort gibt man über fünf Prozent des BIP für die Verteidigung aus. Der Anteil der Militärausgaben an den Gesamtausgaben lag 2022 in Israel bei 13 Prozent gegenüber zwei Prozent in Deutschland. Größter Ausgabenposten hierzulande ist, wie gesagt, der Sozialhaushalt, der 69 Prozent aller öffentlichen Mittel absorbiert. In Israel haben die Sozialausgaben lediglich einen Anteil von 41 Prozent. Dabei ist die Staatsquote Israels niedriger als in Deutschland. Es stimme gerade nicht, dass hohe Rüstungsausgaben nur durch höhere Schulden finanzierbar sind, sagt der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest: Trotz des viel höheren Militärbudgets, lag die Schuldenquote Israels 2023 bei 61 Prozent – ungefähr so hoch wie hierzulande.
Wer also soll das bezahlen? Zum Beispiel wir Boomer, finde ich. Werden wir deshalb abschließend persönlich. Ich habe in den siebziger Jahren den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert und Zivildienst geleistet, weil ich von einer friedlichen Welt ohne Panzer geträumt habe. Der Traum ist nicht wahr geworden. Doch meine Generation hat siebzig Jahre lang in Frieden gelebt (der USA und der Nato sei Dank). Ich möchte, dass auch die nachfolgenden Generationen in Frieden leben. Dafür muss jetzt aufgerüstet werden, getreu dem in unserem Lateinunterricht gelernten Grundsatz »si vis pacem para bellum«. Würden wir von Frieden und Wirtschaftswunder Privilegierten uns damit begnügen, dass unsere Renten künftig »lediglich« an die Inflation angepasst, aber von der Lohnentwicklung entkoppelt würden, würde auf die Jahre eine erkleckliche Summe frei. Vielleicht kann das mal eines der Leibniz-Institute ausrechnen. Unser »Opfer« hielte sich in Grenzen: Real bliebe uns die Kaufkraft erhalten; das Rentenniveau freilich würde sinken. Das würde das Finanzierungsproblem des künftigen Friedens nicht lösen, aber lindern.
Rainer Hank
21. Februar 2025
Lasst Minderheiten regieren
…denn das stärkt die Demokratie in Zeiten der Polarisierung
Minderheitsregierungen haben hierzulande einen schlechten Ruf. Sie gelten als Indiz einer Krise der Demokratie. Dahinter steckt ein autoritäres Bedürfnis, das, sind wir ehrlich, in uns allen steckt: Es soll einen/eine geben, die weiß, der die Bürger vertrauen (»Sie kennen mich!«), der wie der Vater in der Familie in kritischen Situationen ein Machtwort spricht (»Basta!«), Führung liefert, wenn sie bestellt wird, und bereit ist, mit Richtlinienkompetenz durchzuregieren. Alles natürlich zum Besten des Volkes. Dieses autoritäre Bedürfnis wird nur befriedigt, wenn eine Regierungspartei die absolute Mehrheit im Parlament hat oder sich diese mithilfe von Koalitionspartnern verschafft. Im Idealfall macht das Kabinett dann einen Gesetzesvorschlag, den ihre Fraktionen im Parlament gehorsamst durchzuwinken haben.
Selbst wenn dieses autoritär-demokratische Regierungsmodell erstrebenswert wäre – die Verhältnisse sind schon lange nicht mehr danach. Dass eine Mehrheitskoalition stabil und kompromissfähig wäre, diesen Wunsch hat die Ampel geduldig als Illusion zerstört. Hinzu kommt: In einer Welt mit zwei großen und einer kleinen Partei – so war die alte Bundesrepublik – lassen sich gut Mehrheiten finden. In den am kommenden Sonntag zu wählenden 21. Deutschen Bundestag könnten womöglich sieben Parteien einziehen, deren jeweilige ideologische Ausrichtung gar nicht so eindeutig zu erkennen ist. Spieltheoretisch ist das ganz schön unübersichtlich.
So wie es aussieht, käme eine von der Union geführte Mehrheitskoalition nur zustande unter tatkräftiger Beteiligung des Personals jener Ampelparteien, die gerade krachend gescheitert sind. Ob das dem Wählerwillen entspräche, bezweifle ich. Insofern waren im Fernsehduell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz gerade jene Passagen irritierend, in denen die beiden einander und dem faulen Kompromiss naherückten. Wenn andererseits die Protagonisten ständig beteuern, dass sie im Grund mit keiner anderen Partei koalierten könnten, sollen wir sie beim Wort nehmen.
Inhalte first
»Bleiben die Dinge, wie sie sind, wird die Entwicklung zwangsläufig auf Minderheitsregierungen zulaufen«, prognostiziert der Rechtswissenschaftler Florian Meinel in einem Buch mit dem Titel »Vertrauensfrage« (2019). Der Historiker Andreas Rödder, CDU-Mitglied, hat seiner Partei schon 2023 empfohlen, es mit einer Minderheitsregierung zu versuchen: »Parlamentarismus heißt, die Inhalte an erste Stelle zu setzen.« Weil Minderheitsregierungen zwangsläufig im Parlament wechselnde Mehrheiten suchen müssen, impliziert dies freilich eine Relativierung der sogenannten Brandmauer zur AfD. Diesen Gedanken nur zu hauchen, hat Rödder damals den Vorsitz der CDU-Grundwertekommission gekostet. Inzwischen ist es genau so gekommen: Seit November 2024 wird das Land von einer Minderheitskoalition regiert. Und die Opposition setzt Entschließungsanträge mit Unterstützung der AfD durch. Ob das böse (»Tor zur Hölle«) oder gut (»all in«) ist, ist noch nicht entschieden.
Minderheitsregierungen kommen in Deutschland auf zweierlei Weise zustande. Zum einen kann eine mehrheitsbildende Partei aus der Regierung ausscheiden. So ist es derzeit. So war es auch nach dem Rückzug der FDP aus den Koalitionen mit der CDU 1966 und mit der SPD 1982. Diese Minderheiten regierten immer nur kurze Zeit und verstärkten den Eindruck, so etwas sei eine Art politischer Unfall in kurzen Übergangszeiten.
Doch es gibt auch einen verfassungsmäßigen Weg nach Artikel 63, Absatz 1 GG. Findet sich bei der Wahl zum Bundeskanzler keine Mehrheit des Parlaments für einen vom Bundespräsidenten vorgeschlagenen Kandidaten, reicht eine einfache Mehrheit – zum Beispiel alle Stimmen der größten Fraktion -, um zum Kanzler gewählt zu werden. Dann hat der Bundespräsident die Wähl, das Parlament aufzulösen oder den Gewählten zum Kanzler zu ernennen.
»Die Minderheitsregierung ist ein Scheinriese«, sagt die Verfassungsjuristin Lea Bosch. Es gehe von ihr keine Gefahr für das parlamentarische Regierungssystem aus. Im Gegenteil könne sie dazu beitragen, dass trotz fragmentierter und polarisierter Parteienlandschaft das Parlament und die Regierung gut zusammenarbeiten. Gestärkt wird das Parlament, wenn es zeigen kann, dass es mehr ist als nur Mehrheitserfüllungsgehilfe der jeweiligen Regierung. Jene Bürger, die die Union als klare Alternative zu Rot-Grün-Schwarz wollen, müssten nicht aushalten, dass Rot oder Grün durch die mehrheitsbeschaffende Hintertür Platzkarten für die Regierungsbank bekämen.
Das Beispiel Dänemark
Hierzulande hält sich hartnäckig die Meinung, Minderheitsregierungen trügen Schuld am Sieg des Nationalsozialismus; das ist allenfalls ein bisschen richtig. Empirische Befunde belegen, dass Minderheitsregierungen international keine Ausnahme, sondern eher den Regelfall darstellen. Vor allem in Nordeuropa, gemeinhin als demokratisch-konsensuale Musterregion angesehen, hat man damit gute Erfahrungen gemacht. In Sachsen-Anhalt ließ sich von 1994 bis 2002 eine rot-grüne und anschließend eine rote Minderheit von der PDS dulden. Das zog nach allem, was man hört, nicht den Zusammenbruch Magdeburgs samt des Umlands nach sich.
Im Gegenteil. Dänemark, wie wir seit der Serie Borgen wissen das Musterland wechselnder Minderheitskoalitionen, hält diese Instabilität seit Jahrzehnten stabil aus. Um die Mehrheit zu sichern, werben die beiden regierenden Parteien um situative Unterstützung von nicht regierenden Parteien. Selbstbewusst regierende Minderheitsregierungen haben den Bau von Brandmauern nicht nötig. Situative Abkommen führen gerade in Dänemark nicht selten dazu, dass im Parlament Gesetze verabschiedet werden, die in jeder zu verhandelnder Sachfrage den Präferenzen der »mittleren« Partei entsprechen – und also auch denen des (Median)wählers. So kommt es dazu, dass sich von der Politik einer Minderheitsregierung mehr Wähler vertreten fühlen als von einer Mehrheitsregierung. Und dass die Extreme geschwächt und gerade nicht gestärkt werden.
Die Dänen machen so etwas ziemlich effizient, sagt der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König. Ob das in Deutschland – bislang ohne Erfahrung auf diesem Gebiet – auch funktionieren würde? Der Rechtswissenschaftler Florian Meinel ist skeptisch: Man solle das parlamentarische System nicht zu einer Spielwiese für Doktrinäre oder Romantiker machen. Aber was wäre die Alternative? Weiterwursteln und zuschauen, wie die extremen Parteien noch stärker würden, die Wirtschaft des Landes dagegen weiter abschmiert?
Eine Minderheitsregierung wäre nach Jahren von Grokos und Ampeln einen Versuch wert. Von der Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Macht kann solch ein Versuch die Politiker nicht dispensieren.
Rainer Hank
12. Februar 2025
Sägen, Baby, Sägen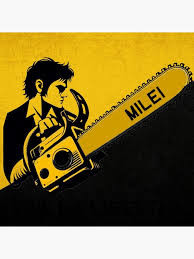
Was wir von Milei lernen können
Woran erkennt man den Wahnsinn der Bürokratisierung? Man muss einfach die Anzahl der Worte aller Gesetzestexte addieren. Und dann zeigt sich: Der Textkorpus der deutschen Gesetze umfasst heute sechzig Prozent mehr Worte als Mitte der neunziger Jahre.
Mehr Gesetze benötigen mehr Menschen, die diese Gesetze zur Kenntnis nehmen und auslegen. Es braucht Behörden, die Verstöße feststellen und ahnden. Kein Wunder, dass die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zwischen 2012 und 2022 von 4,5 Millionen auf 5,2 Millionen zugenommen hat. Deutschland schrumpft, aber der öffentliche Dienst wächst.
Die EU hält mit Deutschland Schritt: Zwischen 2019 und 2024 hat Brüssel 13.942 Vorschriften für Unternehmen erlassen. Im Vergleich dazu hat die USA im gleichen Zeitraum lediglich 3.725 Gesetze erlassen und 2.202 Resolutionen. So notiert es der im September vorgelegter Report des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi.Machen all diese bürokratischen Vorschriften und Gesetze die Welt sicherer, die Menschen glücklicher und die Risiken des Lebens geringer? Darüber gibt es keine Forschungen. Erforscht ist hingegen: Die Wachstumsschwäche Deutschlands ist (auch) eine direkte Folge der Überregulierung. Die Kosten lassen sich beziffern. Der deutsche Maschinenbau etwa nennt bezogen auf die Gesamtkosten 1 bis 3 Prozent für Bürokratie. Über alle Branchen gehen in der EU bis zu vier (!) Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch Bürokratie »verloren«. Das sind einerseits Kosten für eine ausladende staatliche Administration, andererseits Kapazitäten, die die Unternehmen vorhalten müssen zur Umsetzung der Lieferkettenverordnungen, Nachhaltigkeitsverpflichten oder Tariftreuegesetze Brüsseler und nationaler Behörden. Besonders aufgebläht wurden die sogenannten Compliance-Regeln. Das sind Vorschriften zur korrekten Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben in einer Firma. »Bürokratieabbau« haben sich viele europäische Regierungen auf die Fahnen geschrieben. Theoretisch. Eine ausufernde Bürokratisierung ist politische Praxis.
Was kann man tun? Deregulierung heißt das Zauberwort, das derzeit wieder einen positiven Klang hat. Deutschland ist damit schon einmal gut gefahren als Ludwig Erhard die völlige Freigabe der Preise durchgesetzt hat. Das wurde zum Gründungsakt des Wirtschaftswunders. Die Deregulierung der neunziger Jahre während der Ära Kohl führte dazu, dass Fliegen, Bahnfahren, Heizen oder Pakete verschicken deutlich billiger wurde. Von guter Deregulierung profitieren alle. Doch die Betroffenen, denen ihre Privilegien genommen werden, jaulen und schicken ihre Lobbys in die Ministerien. Das Taxigewerbe wehrt sich gegen die Konkurrenz von Uber, das bessere Leistungen zu billigeren Preisen bietet. Die Apotheker drohen mit dem Verfall der Volksgesundheit, sollte es Medikamente auch bei Rossmann geben. Und die Mietervereine malen wachsende Armut an die Wand, sollten die Preise der Wohnungen nicht mehr gedeckelt sein, sondern sich einfach nach Angebot und Nachfrage richten.
Was Ferdico Sturzenegger zu erhählen hat
Gegen die lobbyistische Verkrustung und bürokratische Erstarrung von Regulierungen hilft die Kettensäge. Das ist das Programm des argentinischen Präsidenten Xavier Milei. FDP-Chef Christian Lindner, zaghaft wie er ist, will »ein bisschen« davon auch in Deutschland. Geht das, ein bisschen Disruption? Ein bisschen schwanger geht bekanntlich nicht.
Eine beeindruckende Zwischenbilanz von Mileis Reformen nach einem Jahr kann man sich im Webinar des Princeton-Ökonomen Markus Brunnermeier auf Youtube anhören. Dort gibt es ein Gespräch mit Federico Sturzenegger, Mileis Minister für Deregulierung und Staatstransformation. So einen Minister könnten wir auch gebrauchen. Sturzenegger, ein Ökonom mit Schweizer Vorfahren, ist Professor an der Universidad de San Andrés in Buenos Aires und lehrt an der Kennedy School of Government der Harvard University.Argentiniens Reformprogramm, so Sturzenegger, besteht aus zwei Teilen. Erstens Fiskalreform, zweitens Deregulierung. Staatsausgaben wurden radikal und mit einem Mal um 30 Prozent gekürzt. Zugleich wurden auch die Steuern drastisch gesenkt. Das führte dazu, dass die Wirtschaft heute wieder zwischen zwei und drei Prozent wächst. Austerität wirkt! Zugleich ging die Inflation von zuvor rund 25 Prozent jährlich auf 0,6 Prozent im Dezember 2024 zurück. Das hat direkte Auswirkungen auf den Wohlstand der Menschen: Mit den Löhnen kann man sich real wieder mehr leisten; es gibt weniger Arme. Der Staatshaushalt verzeichnet Überschüsse.
Wie macht man Deregulierung, um nicht gleich an der Mauer der Bedenkenträger abzuprallen? Sturzenegger erzählt das sehr konkret. Als erstes wurden die Gesetze in drei Gruppen eingeteilt: gute Gesetze (können bleiben), überflüssige Gesetze (fallen weg) und verbesserungsfähige Gesetze. Für den Überarbeitungsprozess gibt es klare Regeln: Keine Arbeitsgruppen, Expertenanhörungen und ewige Palaver. Jeder, der einen Verbesserungsvorschlag hat, soll diesen gleich in das Gesetz schreiben. Wird der Vorschlag für gut befunden und dem Parlament vorgelegt, stellt die Regierung ihn direkt auf die Plattform X – bevor die Lobbyisten ihre Abwehrgeschütze in Anschlag bringen können. Gesetze laufen nicht ewig, sondern werden mit einem Verfallsdatum versehen (wie Joghurts im Supermarkt).
Besser mal ein Flugzeug verpassen
Argentiniens Regierung schreckt auch vor Gehaltskürzungen und Personalabbau im öffentlichen Dienst nicht zurück. Das ist zwingend, wenn man den Haushalt reformieren will. Schlimm mag das im Einzelfall sein. Insgesamt ist es nicht schlimm: Weil die Wirtschaft wieder wächst, werden dort neue Leute zu besseren Löhnen eingestellt.
Das ist noch nicht alles. Als nächsten Akt kündigte Milei jüngst eine Änderung der Finanzverfassung an. Kompetenzen sollen auf dezentrale Ebenen verlagert werden. Vorbild ist der Finanzföderalismus der Schweiz, der direkte Demokratie mit Fiskalsouveränität vor Ort verknüpft. Das hätte nicht nur größere Haushaltsdisziplin zur Folge, sondern zöge auch demokratische Partizipation und Zufriedenheit der Bürger nach sich.Friedrich Merz sollte rasch eine Wirtschaftsdelegation nach Buenos Aires zu Minister Sturzenegger schicken. Klar muss dem mutmaßlich nächsten deutschen Kanzler sein, dass vom »Programm Kettensäge« auch die Subventionsempfänger in der eigenen Klientel betroffen wären – Landwirtschaft, Kirchen, Öffentlicher Rundfunk zum Beispiel. Das Motto der Deregulierung wäre: Weniger Bürokratie, mehr wirtschaftliche Effizienz. Es geht um ein Klima der Risikobereitschaft, das das Scheitern nicht bestraft. Wie sagt der Harvard-Ökonom und Sturzenegger-Kumpel Ricardo Hausmann: »Wer noch nie ein Flugzeug verpasst hat, verbringt zu viel Zeit auf Flughäfen«.
Rainer Hank
