Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen
14. April 2025Lauter Opportunisten
07. April 2025Die Ordnung der Liebe
29. März 2025Streicht das Elterngeld
17. März 2025Der Kündigungsagent
17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen
04. März 2025Kriegswirtschaft
21. Februar 2025Lasst Minderheiten regieren
12. Februar 2025Sägen, Baby, Sägen
12. Februar 2025Der Kiosk lebt
27. Januar 2021
Vorfahrt für Geimpfte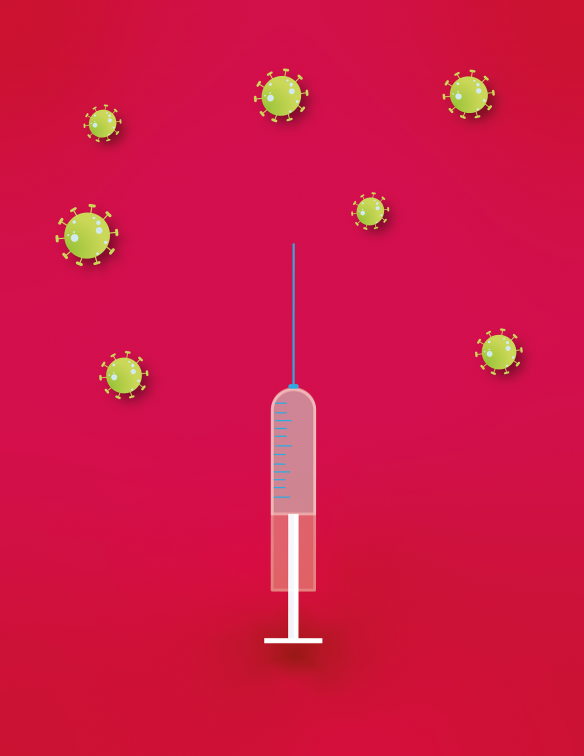
Zwang als Solidarität zu verkaufen geht gar nicht
An ihren Worten könnt ihr sie messen: Es war ein Sozialdemokrat, der Außenminister und Vizekanzler Heiko Maas, der als erster Spitzenpolitiker dafür warb, Bürger, die gegen Corona geimpft wurden, in die Freiheit zu entlassen. Vom neu gewählten Vorsitzenden der CDU, Armin Laschet, war zu diesem Thema nichts dergleichen zu vernehmen. Eine verpasste Chance, finde ich: Laschet hat die Gelegenheit verschenkt, am Start seiner bundespolitischen Karriere konkret zu werden – und zugleich seine Partei einzunorden. In jeder Sonntagsrede betonen CDU-Leute, man sei konservativ, christlich und liberal. Jetzt, wo das liberale Bekenntnis konkret werden könnte, pennt Laschet.
Wäre er gefragt worden, hätte Laschet Maas mutmaßlich entschieden widersprochen und – wie in früheren Interviews – als »obersten Wert« verkündet, es dürfe kein »indirekter Impfzwang ausgeübt« werden. Da zeigt sich ein zutiefst paternalistisches Politikverständnis, dem die Ruhe im Land wichtiger ist als die Freiheit. Aus Angst vor den »Impfgegnern« wird den Geimpften ihre Freiheit vorenthalten. Man sollte hier besser von Diskriminierung der Geimpften statt von Privilegierung reden.
Das Argument für die Freiheit ist nicht kompliziert, hierzulande aber auch nicht sehr beliebt: Freiheit ist in einer liberalen Demokratie der höchste Wert und die logische Voraussetzung aller anderen Werte. Deshalb steht sie auch in der Verfassung an oberster Stelle: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dieses Recht wird dem Bürger weder vom Staat, noch von sonst jemandem gnädig verliehen. Freiheit ist kein Privileg, sondern Selbstverständlichkeit. Der Bürger hat seine Freiheit quasi immer schon. Der Staat braucht Gründe, wenn er die Freiheit einschränkt.
Schlag nach bei John Stuart Mill!
Ein Geimpfter muss von und vor niemandem geschützt werden. Heiko Maas hat Recht: der Geimpfte nimmt niemandem ein Beatmungsgerät weg. Niemand hat Nachteile. Je schneller die Geimpften wieder in die Kinos, die Restaurants und auf die Skipisten kommen, umso rascher kommen wir auch wirtschaftlich wieder in die Normalität zurück. Doch eher liebäugeln die Politiker mit gesetzlichen Eingriffen in die Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen Gastwirten und Gästen.
Bleiben wir noch kurz beim Grundsätzlichen und rufen als Gewährsmann den großen englischen Freiheitsphilosophen John Stuart Mill (1806 bis 1863) mit seiner Schrift »On Liberty« in den Zeugenstand: Danach ist Freiheit jene Grenzziehung, die es jedermann (eben erst recht auch dem Staat) verbietet, sich in die Entscheidungen und Handlungen der Bürger einzumischen und ihnen Vorgaben zu machen. Freiheit ist das Recht, zu tun und zu lassen, was ich will. Mill fügt sogleich hinzu, dass dieses Recht dann und nur dann eingeschränkt werden darf, wenn die Freiheit des einen den anderen schädigt. Absolute Freiheit findet ihre Grenze an der Freiheit und dem Recht auf Unversehrtheit des anderen.Wie weit der Respekt vor der Freiheit geht, dafür gibt es bei Mill ein berühmtes Beispiel: Ein Ausländer, der im Begriff ist über eine einsturzgefährdete Brücke zu gehen und die warnenden Rufe der Umstehenden nicht verstehen kann, darf zwar von anderen am Weitergehen gehindert werden – aber nur, damit er sich der Gefahr bewusst wird. Ebenso darf ein Selbstmörder an seiner Tat nur gehindert werden, wenn er offenkundig krank und nicht Herr seiner Sinne ist.
Halten wir also zur künftigen Orientierung im politischen Spektrum fest (man muss jetzt ja schon Strichlisten machen für die Wahl im Herbst): Der christlich-konservativen Union ist die Freiheit egal, der gewöhnlich egalitär argumentierenden Sozialdemokratie nicht. Eine Solidaritätsadresse des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz an Heiko Maas wäre freilich dringend nötig. Christian Lindner von der FDP, angeblich auch eine Partei der Freiheit, warnt ähnlich wie Laschet vor einer Zweiklassengesellschaft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften. Ein klares Bekenntnis zur Freiheit klingt anders; Warnungen vor Zweiklassengesellschaften kommen in der Regel eher von den Linken. Das Wort »Ausgangs-Sperre«, was im Klartext bedeutet, Bürger in ihre Wohnungen einzusperren, kommt vielen Politikern derzeit flüssiger über die Lippen als das Wort »Freiheit«.
Es gilt das Gebot der Verhältnismäßigkeit
Kommen wir jetzt zu den Gegenargumenten und prüfen sie an Mills Freiheitsverständnis: Freiheitsrechte für die Geimpften bedeuten mitnichten einen Impfzwang durch die Hintertür, also keine Einschränkung der Freiheit anderer. Jedermann ist frei, sich nicht impfen zu lassen, muss aber wie sonst auch die Konsequenzen seiner Freiheitsentscheidung tragen. Weil ein nicht Geimpfter potenziell eine Gefahr für Gesundheit und Leben seiner Mitmenschen darstellt (und vice versa), sind ihm Einschränkungen seines Freiheitsgebrauchs zuzumuten, solange sie sich am Gebot der Verhältnismäßigkeit orientieren. Der Freiheitsgewinn wird ein Anreiz, sich impfen zu lassen. Was spricht gegen Anreize?
Ist es aber womöglich ein Gebot der Solidarität, Geimpfte so zu behandeln wie Nicht-Geimpfte? Solidarität mit den Schwächeren? Was hätte ein Nicht-Geimpfter davon, dass einem geimpften Paar Kaffee und Kuchen in der Konditorei verweigert wird? Nichts, außer einer Befriedigung seines Neidgefühls. Das Solidaritätsargument wird auch nicht besser durch den zusätzlichen Hinweis etwa der Kanzlerin, viele Impfwillige müssten noch lange warten, bis sie dran sind. Viel eher ließe sich diese der Not geschuldete Geduldsprobe als Akt der Solidarität bewerben – den Alten und Kranken und dem Pflegepersonal den Vortritt zu lassen ist solidarisches Handeln, eben weil diese Personengruppen von Corona am stärksten gefährdet sind.
Nun zum Vorwurf der Zweiklassengesellschaft. Das Argument ist triftig, denn dahinter steckt viel Wahrheit: Freiheit schafft Ungleichheit. Das ist unvermeidlich. Wer seine Begabung dazu nutzt, ein berühmter Cellist oder ein erfolgreicher Spekulant zu werden, unterscheidet sich danach von all jenen, die es nicht so weit gebracht haben. Wer es mit der Freiheit ernst meint, muss diese Ungleichheit in Kauf nehmen. Sozialisten, Kommunisten und Urchristen wollen das nicht und geben der Gleichheit den Vorzug.
Schließlich zum Totschlagargument, womöglich würden auch Geimpfte das Virus als Transporteur an Nicht-Geimpfte weitergeben. Da tappen die Weisen offenbar tatsächlich noch im Dunkeln. Doch müsste man nicht vom Standpunkt der Freiheit aus den Spieß umdrehen? Die Beweislast haben jene, die den Geimpften zu einem Gefährder machen. Solange das nicht feststeht, hat er frei seiner Wege zu gehen. Ein Generalverdacht allein reicht zur Freiheitsbeschränkung nicht aus. Zumal im Totschlagargument ein Denkfehler steckt: Der Geimpfte trifft in der Freiheit doch nur auf seinesgleichen: andere Geimpfte oder frisch negativ Getestete. Es kann also wenig schief gehen. Oder wollen wir die Freiheit suspendieren, bis die ganze Menschheit immun ist?
Es ist dringend nötig, die Welt wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Impfen, impfen! Testen, testen! Für alle, die geimpft oder getestet sind, tritt der Normalfall der Freiheit ein: Sie können und sollen mit allen, die getestet und geimpft sind, reisen, musizieren, Autos bauen, Feste feiern.
Rainer Hank
18. Januar 2021
Kommen jetzt die Roaring Twenties?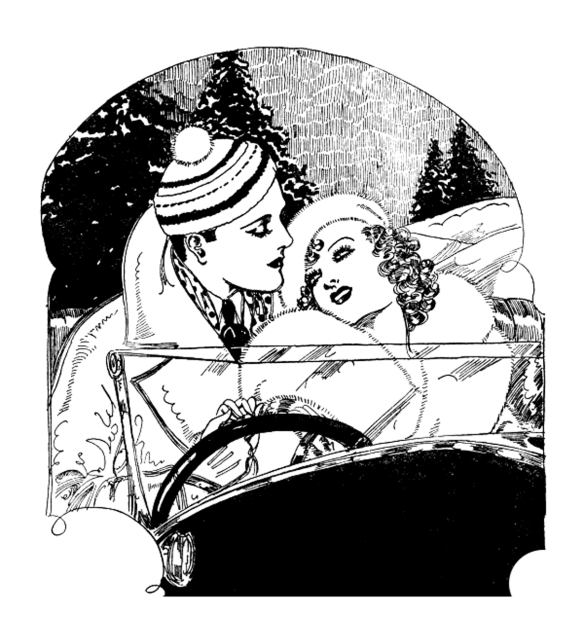
Das wird lustig, wenn Corona endlich vorbei ist
In Zeiten des Lockdowns haben wir viel Muße zu sinnen, wie die Welt aussehen wird, wenn diese Pandemie vorbei ist – oder wenigstens so viele Menschen geimpft sein werden, dass ein normales Leben möglich sein wird. Ich jedenfalls, der ich nie ein großer Fernreisender war, sehe mich mehrere Wochen in Südafrika verbringen und anschließend den Lockrufen derer nachzugeben, die mir immer schon von Neuseeland vorschwärmten. In der Nacht sind meine Träume derart bevölkert, dass ich mir beim Aufwachen große Feste vorstelle mit noch den entferntesten Bekannten. Der Caterer bekommt, meinem schwäbischen Naturell zum Trotz, den Auftrag, richtig in die Vollen zu gehen. Später dann schließen sich mindestens zwei Wochen New York an, wo kein einziger Konsumwunsch unerfüllt bleiben soll. Ein Paradox des Corona-Zeit besteht ja darin, mehr Geld zu haben als wir ausgeben können. Vornehm gesagt: Die Konsummöglichkeiten hinken den verfügbaren Einkommen hinterher.
Höre ich mich bei Freunden um, die bislang nicht dafür bekannt waren, das Geld mit vollen Händen auszugeben, scheint es denen ähnlich zu gehen. »Wir wollen es krachen lassen und mit allen Schikanen essen gehen«, whatsappt eine Berliner Freundin. Es ist, als ob wir uns kollektiv zu einer Art von Belohnungskonsum berechtigt fühlen. Käme es so, hätte die Sause den nicht zu verachtenden Nebeneffekt, dass wir uns um die Konjunktur nach Corona keine Sorgen machen müssten: An unserer aggregierten Nachfrage wird es nicht scheitern. Am Angebot wohl auch nicht, denn anders als nach Kriegszeiten können Fabriken und Geschäfte auf der Stelle hochgefahren werden, wenn der Spuk vorbei ist.
Was spricht dafür, dass wir einen derartigen Boom erleben werden? Hört man sich um, so teilen sich die Prognostiker etwa halb und halb in Pessimisten und Optimisten auf. James Rickards etwa, ein sehr erfolgreicher amerikanischer Untergangsprophet, sieht die Welt auf direktem Weg in eine neue »Große Depression«. Hat er recht, wird uns nichts erspart bleiben: Deflation, Schuldenchaos, Arbeitslosigkeit und demographische Verwerfungen lassen uns in seinen Büchern jetzt schon in Abgründe blicken. Rickards beruft sich auf die renommierte Harvard-Ökonomin Carmen Reinhart, die der Ansicht ist, die Zeit nach Corona werde den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ähneln. Das kann heiter werden.
Reaktion auf die Spanische Grippe
Gottlob finden sich auch Optimisten. Nicholas Christakis, ein an der Universität Yale lehrender Sozialwissenschaftler, deutet die »Roaring Twenties« des 19. und 20. Jahrhundert als eine Reaktion auf die Spanische Grippe 1918 bis 1920. Wer damals erlebt hat, welchen Verzicht kultureller Ausdrucksmöglichkeiten mehrere Lockdowns bedeuten, entwickelte vitale Kräfte, das Leben in vollen Zügen zu spüren. Dem schließt sich Klaus Kaldemorgen an, ein erfahrener Fondsmanager Deutschlands: »In den Goldenen Zwanzigern gab es einen gewaltigen Börsenaufschwung, nachdem die spanische Grippe überwunden war«, sagt er im Gespräch mit der F.A.S.
Alles hängt davon ab, ob wir als Referenzjahr zu heute wie die Pessimisten das Jahr 1930 nehmen oder wie die Optimisten das Jahr 1920. Stehen wir – wirtschaftshistorisch gesehen – vor den Zwanziger- oder den Dreißigerjahren? Wenn mein »Wunschdenken« die Realität bestimmen könnte, wüsste ich, wie es ausgeht. Wer Recht hat, wissen wir erst in zehn Jahren. Aber nach spekulativen Plausibilitäten können wir fahnden.
Nachfrage bei Harold James, einem Professor der Universität Princeton, der viel über die Wirtschafts- und Finanzgeschichte des 20. Jahrhunderts geforscht hat. Harold James outet sich als Optimist. »Wir werden die Segnungen der Globalisierung zurückgewinnen«, mailt er mir und verweist auf seine Forschungen zur Frage, wie sich die Wirtschaft nach sogenannten Angebotsschocks entwickelt hat. Allemal, so das Resultat des Wissenschaftlers, wurde die weltweite Vernetzung der Wirtschaft nach solchen Krisen nicht etwa beschnitten, sondern sogar noch ausgeweitet – mit positiven Auswirkungen für den Wohlstand der Menschen.
Return to Normality
Dieser Wohlstandsgewinn lässt sich an der Dekade zwischen 1920 und 1929 im Detail nachzeichnen. Der amerikanische Politiker Warren G. Harding (1865 bis 1923), ein Republikaner, wurde 1921 zum Präsidenten gewählt mit dem Slogan »Return to Normality«, zurück zur Normalität. Damit traf er offenbar einen Nerv der Zeit, ein optimistisches Grundgefühl eben. Die Wirtschaft entwickelte sich prächtig. Die Amerikaner, bis dahin eher calvinistisch-sparsam, entwickelten große Freude am Geldausgeben und hatten auch keine Scheu, auf Pump zu konsumieren. Henry Ford kam kaum mit der Fließbandfertigung seines T-Modells kaum nach. Waschmaschinen, Kühlschränke, Bügeleisen und Nähmaschinen galten unter den Hausfrauen als der neueste Schrei. Die Erfindung der Werbung sorgte dafür, dass die neuen Produkte auch überall im Land bekannt und als begehrenswert erachtet wurden. Vor dem Krieg hatten sich nur die Reichen Aktien geleistet, jetzt wurde die amerikanische Börse ein Tummelplatz für jedermann. Teure Mode verführte Männer wie Frauen. Das öffentliche Leben blühte überall auf. New York wurde zur Hauptstadt des Jazz (Louis Armstrong, Duke Ellington); Hollywood entwickelte sich zur Welthauptstadt der Filmindustrie. Wer es genauer haben will, braucht bloß »The Great Gatsby«, den 1925 veröffentlichten Roman von F. Scott Fitzgerald zu lesen.
Das Deutschland der zwanziger Jahre war alles in allem nicht ganz so glamourös. Aller heutigen Mythen zum Trotz war Berlin kein Babylon. Autos oder Haushaltsgeräte für jedermann gab es erst im Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg. Das Wohlstandsgefälle zwischen Amerika und Deutschland war viel größer als heute Aber gleichwohl: Auch Deutschland blühte auf, und das war nicht nur eine Scheinblüte, wie manche Historiker meinen. Schon bald waren Produktion und Einkommen wieder auf das Vorkriegsniveau angestiegen. Massenkonsum und Massenunterhaltung wurden zur Signatur der Zeit; zugleich leisteten es sich die Deutschen, Bismarcks Sozialstaat weiter auszubauen.
Natürlich können die zwanziger Jahre in Deutschland und Amerika nicht zur Blaupause für unsere Zeit übernommen werden. Vor allem fehlen uns heute die in die Massenproduktion eingehenden technischen Innovationen von damals; der zu erwartende Digitalisisierungsschub nach Corona wird das nicht leisten. Aber das optimistische Grundgefühl könnte jener positiven Stimmung von damals ähneln. Stimmungen und Gefühle als Konjunkturtreiber – die berühmten »animal spirits« von John Maynard Keynes – sollte niemand unterschätzen.
Beckmesser werden jetzt daran erinnern, wie die zwanziger Jahre endeten: mit einem schlimmen Börsencrash im Oktober 1929, gefolgt von Schuldendeflation, Bankenkrise, Arbeitslosigkeit, den barbarischen Nazis und einem schrecklichen Krieg. Doch Geschichte muss sich ja nicht komplett wiederholen. Wir – geleitet von klugen Fiskal- und Geldpolitikern – hätten ja noch bis 2029 Zeit dafür zu sorgen, dass es dieses Mal besser endet. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, wenn ein deutscher Kanzlerkandidat des Jahres 2021 – ähnlich wie damals Warren G. Harding – mit dem Wahlspruch »Auf in die wilde Normalität« in den Kampf zöge. Meine Stimme hätte er.
Rainer Hank
12. Januar 2021
Hans im Unglück
Wer zu spät kommt, taugt nicht zum Spekulanten
Dass ich zum Spekulanten nicht tauge, hat mir diese Corona-Krise wieder einmal eindrücklich vor Augen geführt. Wenn wir schon unter dieser gottverdammten Pandemie leiden, so dachte ich, dann ließe sich zur Entschädigung nach Wegen am Aktienmarkt suchen, davon wenigstens finanziell zu profitieren. Doch da ging es mir nicht anders als der EU, die im Sommer vor der Frage stand, welches Pharmaunternehmen als erstes mit einem Impfstoff auf den Markt kommen würde. Dass Biontech das Rennen machen würde, konnten nur Hellseher wissen. Und als man es dann wusste, war es zum Investieren zu spät, weil die Kurse längst durch die Decke gingen.
Was mir nicht in den Sinn kam, war eine alte Spekulanten-Weisheit aus den Zeiten des amerikanischen Goldrausches. Statt in Goldminen zu investieren, empfiehlt es sich, Aktien der Schaufel- oder Siebhersteller zu kaufen. Denn Schaufel und Sieb braucht jeder Goldsucher, einerlei, ob er am Ende fündig wird oder nicht. Wer stellt eigentlich die Gläschen her, in die jetzt die Impfdosen abgefüllt werden? Woher kommen die Milliarden an Spritzen? Und wer fertigt die Kühlaggregate, die den Biontech-Impfstoff auf minus 70 Grad eisgekühlt halten? Das sind die Schaufelhersteller der Corona-Pandemie.
Nun gut, der Schaufel-Einfall kam mir ebenfalls nicht. Besser gesagt: er kam mir erst, nachdem ich einen Artikel im F.A.Z.-Finanzteil darüber gelesen hatte. Und da war es dann abermals zu spät und die Gerresheimer-Aktie (Glasfläschchen) schon viel zu teuer. Merke: Wer zu spät kommt, taugt nicht zum Spekulanten.
Wer weiß, was ein ETF ist?
Mein einziger Trost: Ich bin in allerbester Gesellschaft. »Geld können wir immer brauchen«, schreibt mir dieser Tage eine Bekannte. Aber um die Geldkompetenz – vornehm »financial literarcy« – steht es in unseren aufgeklärten Zeiten zum Trotz nicht zum Besten. Gerne würde ich die Wette machen, wie viele W3–Professoren deutscher Universitäten wissen, was ein ETF ist. Nicht sehr viele, vermute ich. Empirisch gut untersucht sind die sogenannten »Big-Three«-Fragen: Da soll man zum Beispiel sagen, ob aus hundert Euro bei einem Zinssatz von zwei Prozent in fünf Jahren exakt 102 Euro oder mehr oder weniger als 102 Euro geworden sind. Lediglich jeder zweite Deutsche beantwortet diese Frage richtig. Kleiner Trost: In Italien kennt nur jeder Vierte die Antwort.
Vieles spricht dafür, dass Geld-Kompetenzen ähnlich wie Klavier- oder Fußballspielen in frühen Jahren erworben werden. Bei uns zuhause galt wie in vielen Familien der Grundsatz, dass man über Geld nicht sprach. Mein Vater hat nie verraten, was er verdient. Ich sah bloß, dass es immer knapp war.
Eine schöne Geschichte erzählt Patrick Jenkins, stellvertretender Chefredakteur der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times. Aufgewachsen im Süden von Wales als Kind eines Musiklehrers und einer Psychologin hätten seine Chancen ziemlich schlecht gestanden, dass aus ihm einmal ein Finanzexperte würde. Doch zu seinem sechzehnten Geburtstag erhielt Patrick ein Geschenk von seinem Vater: British-Telekom Aktien im Wert von hundert britischen Pfund, ausgegeben anlässlich der Privatisierungswelle in den Thatcher-Jahren. Die Folge: Patrick Jenkins studierte täglich aufmerksam die Kursseiten des Daily Telegraph, freute sich über jedes Pfund, das sein kleines Depot an Wert zunahm. Und, was noch mehr wert war, fortan wusste er Bescheid. Das, so sieht er es selbst, war die Voraussetzung dafür, dass er heute an der Spitze einer der wichtigsten Finanzzeitungen der Welt steht.
Es gab in Deutschland viele Eltern und Patenonkel, die nach dem Fall des Postmonopols in den neunziger Jahren ein kleines Päckchen Telekom-Aktien von Ron Sommer den Neugeborenen als Taufgeschenk mitbrachten. Das ist gründlich schief gegangen. Aus Schaden wird man nicht in jedem Fall klug: Seither halten sich viele Deutsche von Aktien fern.
Das Hans-im-Glück-Syndrom
Es gibt eine noch gefährlichere Art finanzieller Unbildung, die auf den ersten Blick als kompetentes Expertentum daherkommt, am Ende aber geradewegs in die Katastrophe führt. Dazu lohnt die Lektüre der vor Kurzem unter dem Titel »Glücksritter« erschienenen »Recherche über meinen Vater« des Berliner Schriftstellers Michael Kleeberg. »Mein Vater hatte immer Pech gehabt, wenn es um Geld gegangen war oder immer die falsche Entscheidung getroffen.« Dabei sei Geld eigentlich zuhause ein großes Thema gewesen, lässt der Rechercheur uns wissen: schon als kleines Kind redeten die Eltern in seiner Gegenwart darüber. Stolz gab sich der Vater, dass er keine »Lohntüte« erhielt, die der Sohn sich wie ein konusförmiges Papiertütchen vorstellte, sondern ein »Gehalt«. Das Gehalt, ausgezahlt am 15. des Monats, erhebt den Angestellten über den Arbeiter, der erst am Monatsende seinen Lohn bekommt.
Der Angestellte dünkte sich etwas Besseres und wollte mehr. Vater Kleeberg machte sich auf den Weg vom Kleinbürger zum Kleinunternehmer – und scheiterte dramatisch. Ein Geschäftspartner, dem er blind vertraute, hatte ihn arg über den Tisch gezogen – am Ende war all sein Geld weg. Um Scham und Schande auszuwetzen stürzte er sich in immer neue finanzielle Abenteuer: In späten Jahren fiel er gar Betrügern zum Opfer, die ihn mit sogenanntem »Vorschussbetrug« abzockten. Der Trick dabei: Bevor das »Versprechen« eines Millionengewinns eingelöst wird, werden die Opfer zu einer »Vorauszahlung« gedrängt. Die versprochene Leistung bleibt jedoch aus. Erst spät war der Sohn dahintergekommen; zehn Millionen Euro hatte der Betrüger dem Vater versprochen, 15000 Euro hatte der Vater ihm dafür als Vorschuss in den Rachen geworfen.
Unverstanden bleibt dem Sohn Kleeberg, warum der Vater, ein Mann, der eigentlich besessen war vom Geld, am Ende seines Lebens finanziell alles falsch gemacht hatte. Finanzielle Un- oder Halbbildung führt dazu, dass das Vermögen darbt. Finanzielle Besessenheit führt schlimmstenfalls dazu, dass am Ende das ganze Geld weg ist.
Warum lernen wir nicht wenigstens aus solchen negativen Erfahrungen? Womöglich hängt es mit einem Phänomen zusammen, das die Psychologen »Hans-im-Glück-Syndrom« nennen und das sich beim Vater des Schriftstellers Kleeberg quasi lehrbuchhaft nachzeichnen lässt. Das Hans-im-Glück-Syndrom kommt bei Zockern (sei es an der Börse oder im Casino) vor, die erst aufhören können, wenn der ganze Einsatz verspielt ist. Dann entsteht – wie im Märchen der Brüder Grimm – ein kurzfristiges Hochgefühl der Befreiung und der Erleichterung, dass es vorbei ist. Aber wie geht es weiter, wenn das Märchen zu Ende ist? Dann folgt der Katzenjammer: Was verloren und verspielt ist, muss um jeden Preis verdrängt werden. Denn sonst wäre Hans im Glück nicht wie es im Märchen heißt der glücklichste, sondern der unglücklichste Mensch auf Erden.
Es bräuchte also wohl nicht nur frühe Bildung über die Effekte von Zins und Zinseszins, den Unterschied von real und nominal oder von Brutto und Netto. Dafür wäre ein Unterrichtsfach »Wirtschaft/Finanzen« sicher hilfreich. Angesichts der komplexen Interdependenz von Geldgier, Verdrängung, Scham und Achtungsverlust zwischen den Generationen sind aber wohl nicht nur die Ökonomen und Pädagogen, sondern auch die Psychologen gefordert.
Rainer Hank
05. Januar 2021
Amazon macht süchtig
Wie ich meinen Glauben an den Internethändler verlor
Seit Jahren zähle ich zu den treuesten Kunden von Amazon in Deutschland. Was habe ich dort nicht alles bestellt: Den Ersatzrost für unseren Backofen, die gesammelten Werke Hegels (unabdingbar im Jubiläumsjahr) oder Ersatzbatterien im Achterset für den Zündschlüssel meines Autos. Und, was soll ich sagen: Ich war immer zufrieden. Die Dinge werden im Netz übersichtlich präsentiert, die Bewertungen der Kunden sind aussagekräftig und die Lieferung erfolgt postwendend bis zu mir in den zweiten Stock, überreicht von ausschließlich freundlichen Mitarbeitern. Selbst die viel gescholtenen personalisierten Empfehlungen (»Kundinnen, die dieses Parfum kaufen, kaufen auch…«) fand ich stets einfühlsam und irgendwie meinen Geschmack treffend.
So habe ich mich in den vergangenen Jahren zu einem informellen Botschafter des kalifornischen Warenversenders im Frankfurter Nordend entwickelt, mannhaft mein Unternehmen verteidigt, wenn ich mir wieder einmal anhören musste, Amazon sei der Tod des Buchhandels, versklave seine Arbeiter und uniformiere den Konsum-Geschmack der Weltbevölkerung. Fast immer war ich in der Minderheit. Nichts hat mich aus der Kurve getragen, stets hatte ich – meiner Ansicht nach – ein schlagendes Gegenargument.
Doch jetzt ist es passiert. In diesen letzten Wochen des Jahres 2020 habe ich den Glauben an Amazon verloren.Und das kam so. Einige kurz hintereinander erfolgte Abbuchungen von Anfang November auf meiner Kreditkartenabrechnung, keine großen Beträge, kamen mir spanisch vor. Ich hatte die Befürchtung, ein Betrüger müsse mein Amazon-Konto gehackt haben. Solche Sachen liest man ja; warum sollte ich verschont bleiben. Ich bat meine Bank, das mutmaßlich betrügerisch abgebuchte Geld von Amazon zurückzufordern. Das funktionierte binnen eines Tages reibungslos. Tags darauf musste ich feststellen, dass es keinen Hacker gab, ich lediglich bei der coronabedingt vielfältigen Online-Bestellerei den Überblick über meine Käufe verloren hatte. So waren mir etwa die Fahrradhandschuhe für 10,97 Euro nicht mehr präsent. Mein Fehler, gewiss, ein Fehler freilich, den ich mir durchgehen lasse. Kann passieren.
Die Sache wird sich ziehen
Seither lerne ich Amazon von einer anderen Seite kennen. Wie naiv war es von mir zu meinen, die Sache lasse sich mit einer korrigierenden Mail an Amazon aus der Welt schaffen. Erst einmal reagierte das Unternehmen gar nicht, dann erhielt ich die Mitteilung, mein Amazon-Konto sei gesperrt, angeblich, um mich zu schützen. Einige Tage später wurde ich aufgefordert, um die Bestellungen zu bezahlen solle ich die Nummer einer Kreditkarte anzugeben, die aber nicht jene Kreditarte sein dürfe, von der ursprünglich die Beträge abgebucht worden seien, sie müsse aber gleichwohl auf meinem Amazon-Konto hinterlegt sein. Das werde schwierig, antwortet ich, denn es sei keine andere Kreditkarte hinterlegt, ich könne das aber jetzt gerne nachholen. Nein, das sei auch nicht möglich, wurde mir einige Tage später mitgeteilt. Da schwante mir, die Sache wird sich ziehen.
Ich kürze ab, aus Angst, Leser zu verwirren (oder zu langweilen). Amazon ächtet mich und schloss mich wochenlang aus der Community aus. Am anderen Ende der Telefon-Hotline traf ich zwar immer auf freundliche Call-Center-Mitarbeiterinnen, die stets versicherten, mein Anliegen weiterzugeben. Ohne Erfolg. Ich wäre bereit gewesen, das Geld persönlich mit Schufa-Zertifikat vorbei zu bringen oder in einem eingeschriebenen Umschlag an Jeff Bezos nach Seattle (Washington) zu schicken. Es nützte alles nichts. Wie Hohn kam es mir vor, dass die in nicht leicht zu verstehendem Deutsch formulierten Mails von »Kontospezialist. Amazon.de« mit dem Hinweis enden: »Unser Ziel: das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Ihr Feedback hilft uns dabei.«
Wechselaufwand für die Nutzer
Ich höre schon die Häme der Leser: Das kommt davon, wenn man sich auf Amazon verlässt. Und ich höre den Vorwurf: Hier wird ein einmaliger Vorfall, für dessen Eintreten ich auch noch selbst verantwortlich bin, generalisiert und zum Vertrauens-Super-Gau hochstilisiert. Diesen Verdacht zu entkräften half mir – wie stets – das F.A.Z.-Archiv. Dort findet sich genügend Material meiner Leidensgenossen, alle mit dem Tenor: Wehe dem, der den geschmierten Automatismus von Amazon stört. Der wird bestraft.
Als dilettierender Kartellexperte hätte ich vor diesem ärgerlichen Vorfall stets behauptet, Amazon sei nicht gefährlich trotz seiner inzwischen 80 Prozent Marktanteile im Online-Handel. Denn das Unternehmen nützt seine Macht ganz offensichtlich nicht aus, mir höhere Preise abzuknöpfen. Das immense Wachstum des Internetgiganten verdankt sich seiner auf Netzwerkeffekten beruhenden Leistung – mit freundlicher Unterstützung von der aktuellen Seuche, die es uns verbietet, beim stationären Händler einzukaufen. Doch jetzt sehe ich: Preissetzungsmacht ist nicht der einzige Schaden, den ein Monopolist den Menschen zufügt. Ich wurde Opfer einer Mischung aus Bürokratismus und Desinteresse am einzelnen Kunden. Der Monopolist braucht sich – allen Marketingsprüchen zum Trotz – nicht mehr besonders anstrengen, wird hochmütig und träge. Bei einem Rekordumsatz von hochgerechnet etwa 380 Milliarden Dollar im Jahr 2020 und einem Gewinn allein in den ersten drei Quartalen von 14 Milliarden Dollar kommt es auf den Kunden Hank nun wirklich nicht an. Abwandern wird er nicht, er hat ja keine Alternative.Hat er wirklich keine Alternative? Marktmacht, so lese ich im deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Paragraph 18, Absatz 3a, sei auch im Hinblick auf den »Wechselaufwand für die Nutzer« zu überprüfen. Dazu könnte ich etwas beitragen. Der Wechselaufwand ist enorm. Denn einen vergleichbaren »Gatekeeper«, bei dem ich wie bei Amazon alles Mögliche bestellen kann, ohne mich jedes Mal durch komplexe Anmeldemenüs (samt Passwort-Wirrwarr) zu hangeln, gibt es nicht. Was habe ich in diesen Wochen an in meiner Not an Zeit und Nerven strapaziert. Bei den Büchern bin ich nach Frusterfahrungen mit Hugendubel schließlich bei Osiander gelandet – sehr zufrieden übrigens. Aber eim Tee oder dem Druckerpapier, stets geht die Registriererei wieder von vorne los.
Wie einfach ist es dagegen bei Amazon. Und genau das ist das Problem. Marktmacht ist verführerisch und bequem für den Kunden. Was mich an mir selbst irritiert: Ich habe mich in diesen Wochen richtig unglücklich gefühlt und offenbar zum ersten Mal mit Erschrecken realisiert, wie abhängig ich von Amazon schon geworden bin. Amazon macht süchtig?
Kann man ohne Amazon leben? Ja, man kann. Aber es ist anstrengend und muss ganz neu gelernt werden. Sagen wir es in den Worten der zuständigen EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Versager: »Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Macht der digitalen Unternehmen, insbesondere der größten Gatekeeper, unsere Freiheiten, unsere Chancen, sogar unsere Demokratie bedroht.« Nun gut, das mit der Demokratie ist – auf meinen Fall bezogen – vielleicht etwas übertrieben.
Postskriptum: Aus heiterem Himmel teilt mir Amazon am Tag vor Heiligabend mit, die »Angelegenheit« sei nun geklärt, es bestehe »kein Handlungsbedarf« mehr und ich werde wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Ob wir noch einmal Freunde werden?
Rainer Hank
28. Dezember 2020
Kein Betriebsunfall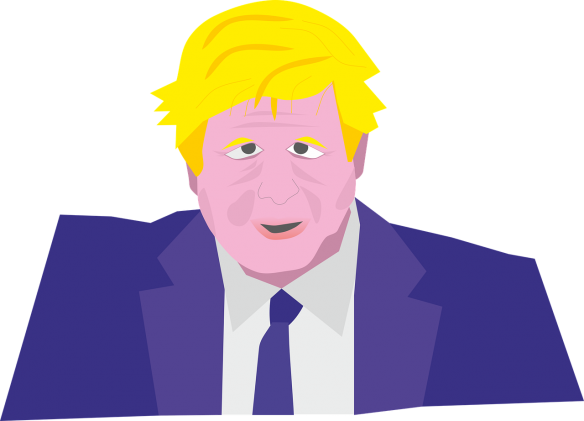
Was der Brexit mit uns Deutschen zu tun hat
Was geschah am 16. September 1992 in London? Hilft die Information, dass der Tag als »Schwarzer Mittwoch« in die Geschichte eingegangen ist? Bei mir fällt kein Groschen. Ich fürchte, in Deutschland geht das heute vielen Zeitgenossen so. Dabei gilt dieser Tag für die Briten als »die schwerste Demütigung seit Suez«. Die Suez-Krise 1956/57, dies erinnern wir aus der Serie »The Crown«, ist ein zentrales Datum des Niedergangs des britischen Empires.
Und der »Schwarze Mittwoch«? Am »Schwarzen Mittwoch« wurde England von der europäischen Gemeinschaft gezwungen, aus dem Europäischen Wechselkursmechanismus auszuscheiden, ein Vorfall, der technisch klingt, dem Land aber eine Abwertung seiner Währung und Verluste von rund 3,3 Milliarden Pfund bescherte. Die Zustimmung zur Regierung der Konservativen und zu Premierminister John Mayor schrumpfte von 42 auf 29 Prozent. Die Schuld für diese Demütigung gab man der Deutschen Bundesbank, die nicht bereit war, den Briten mit einer Zinssenkung zu Hilfe zu kommen und der Bundesregierung, die sich seit der Wiedervereinigung als verantwortungsloser Hegemon in Europa aufspielte. Der Spekulant George Soros hatte früh den richtigen Riecher und erfolgreich gegen das Pfund gewettet.
Aus der Geschichte des »Schwarzen Mittwochs« lässt sich einiges lernen. Zunächst dies, dass Traumata länger im kollektiven Gedächtnis haften bleiben als Siege. Damit könnte auch zusammenhängen, dass wir Deutschen große Schwierigkeiten haben, Verständnis für den Austritt der Briten aus der Europäischen Union aufzubringen. Vorwurfsvoll tönt es bis heute, wie man so töricht sein könne, aus falsch verstandenem Nationalstolz auf all die Segnungen der Europäischen Gemeinschaft zu verzichten. Konsequenterweise stößt die beleidigt-unnachgiebige Position Brüssels bei den Brexit-Verhandlungen bei uns auf große Zustimmung: Nachahmer Großbritanniens seien gewarnt!
Begleitlektüre zum Abschied der Briten
Der »Schwarze Mittwoch« war eine Wende; seither haben die Euroskeptiker in England Oberwasser. So lese ich es bei dem Politikwissenschaftler Vernon Bogdanor, einem Professor am King’s College in London. Dabei war es in den Jahren vor 1992 der britischen Regierung mühsam und nach zwei Referenden gelungen, für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1972 im Volk Rückhalt zu bekommen. Vernon Bogdanors gerade erschienenes Buch »Britannien und Europa in einer unruhigen Welt« (Yale University Press) empfiehlt sich als Begleitlektüre zum derzeit ablaufenden letzten Akt des Brexit. Für mich ist es eines der besten Europa-Bücher seit langem. Am Ende bringt der Leser viel Verständnis für den Brexit auf, obwohl oder gerade weil der Autor kein Brexiteer ist, sondern findet, sein Land hätte besser daran getan, in der EU zu bleiben.
Die These des Buches: Der Brexit ist kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern Ergebnis eines gespannten Verhältnisses der Briten zum Kontinent, welches immer schon ambivalent war und ambivalent geblieben ist. Großbritannien hat sich dem Gemeinsamen Markt, der Europäischen Gemeinschaft und zuletzt der EU stets nur zögerlich beigesellt, den Euro gemieden und in den Jahrzehnten der EU-Mitgliedschaft sich nie vorbehaltlos nach Europa orientiert. Das hat viele Gründe und hängt zusammen mit der jahrhundertelangen Dominanz einer Seemacht über ein globales Imperium. Wer wollte sich da plötzlich von Frankreich oder Deutschland reinreden lassen? Sichtbar wird diese gefühlte Distanz in einer Radioansprache von Neville Chamberlain zum Münchner Abkommen 1938: Der Premier fand, es sei »unglaublich«, dass England gezwungen werde, sich um einen Konflikt, »in einem weit entfernten Land zwischen Völkern, von denen wir nichts wissen«, zu kümmern. Von London nach München sind es gut tausend Kilometer. Chamberlain hätte nicht so verständnislos geredet, wäre es um einen Konflikt in Sydney gegangen, eine Stadt, die von London über 10 000 Kilometer entfernt ist.
Trojanische Pferde aus der Büchse der Pandora
Es fehlte denn auch bei Labour wie bei Torys nie an gewichtigen Stimmen, die mahnten, sich der Vergemeinschaftung Europas zu widersetzen. Vernon Bogdanor zitiert den hübschen Ausspruch eines Labour-Politikers aus den späten vierziger Jahren: »Wer die Büchse der Pandora öffnet, kann nie wissen, welche trojanischen Pferde herausfliegen.« Es waren vor allem sehr konträre ökonomische Konzepte, die Festlandeuropäer und Briten mit der Gemeinschaft verbanden. Das begann mit der Landwirtschaft: Großbritannien profitierte von den günstigen Importen aus dem Commonwealth. Die eigene Landwirtschaft, nie wirklich systemrelevant, unterstützte man mit Steuermitteln. Frankreich und Deutschland hingegen garantierte ihrer Landwirtschaft feste Abnahmepreise. Der Unterschied ist erheblich: Einmal zahlen die Steuerzahler für die Landwirtschaft, das andere Mal die Verbraucher – zum Schaden der Importeure aus außereuropäischen Ländern. Das zeigt, dass die Europäische Gemeinschaft seit ihren Anfängen selbst ein ambivalentes Konstrukt ist – nach innen liberal, nach außen eine illiberale Festung.
Niemand hat diesen illiberalen Charakter der EU besser gesehen als Margaret Thatcher, die je älter umso europaskeptischer wurde. Habe am Ursprung der Gemeinschaft ein Programm wirtschaftlicher Freiheit für alle Mitglieder gestanden, so werde dies immer mehr unterlaufen von Vergemeinschaftungs-Aktonen der Geld- und Sozialpolitik, die den Marktmechanismus aushebeln. »Wir haben nicht bei uns erfolgreich den Staat geschrumpft, um uns am Ende einem von Brüssel dominierten europäischen Super-Staat zu unterwerfen«, sagte die Eiserne Lady in einer berühmten Europa-Vorlesung in Brügge 1988. Paradoxerweise trieben die Sozialisten im Königreich völlig entgegengesetzte Sorgen um: Während Thatcher Europa als marktfeindlich schalt, wähnte Labour die EU als marktliberales Projekt kalter Deregulierung und Privatisierung, welches ihrem Ziel einer sozialistischen Gesellschaft zuwiderlief. Die Vorbehalte könnten konträrer nicht sein, das Ergebnis ist identisch: Lasst uns auf der Insel mit der Europäischen Gemeinschaft in Ruhe. Ob nach dem Brexit das Königreich isolationistisch-protektionistisch oder womöglich doch wirtschaftlich offener dasteht als die EU (»Singapur an der Themse«), ist im Übrigen noch nicht entschieden.
Es war nicht erst die Finanz- und Flüchtlingskrise nach der Jahrtausendwende und erst recht nicht lediglich das Aufkommen eines irrationalen Populismus, welches die Brexit-Mehrheit des Referendums von 2016 erklärt. Die Briten hatten immer schon Gründe, sich in der EU unwohl zu fühlen. Vernon Bogdanor gibt den Völkern der EU den guten Rat, auch ihrerseits diese Sorgen ernst zu nehmen. Lernen ist besser als sich entrüsten. Was das heißt? Abschied nehmen vom Pathos einer »ever closer union« mit entsprechendem immer größerem Souveränitätsverlust für die Nationalstaaten unter einem supranationalen Brüsseler Regime. Besser wäre es, die EU als engen Verbund nationaler souveräner Regierungen weiterzuentwickeln. Es ist jedenfalls nicht alternativlos, die Sicherung des Völkerfriedens ausschließlich von den Vereinigten Staaten von Europa erzwingen zu wollen. Dass auch Vielvölkerstaaten am Ende kriegerisch scheitern können ist die Lehre von 1914 und die Botschaft aus dem Zerfall Jugoslawiens 1992.
Rainer Hank
